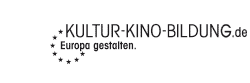Erfrischend ja, erhellend nein
Die Berechnung von Wasserpreisen ist kein Selbstläufer – Thema 04/13 Unser Wasser
Im September des vergangenen Jahres war dem Vertriebsleiter der Stadtwerke Solingen (SWS) Stefan Ziebs gar nicht zum Lachen. Die Statistikbehörde des Landes IT NRW wies der Stadt Solingen einen Trinkwasserpreis von 2,68 Euro pro Kubikmeter aus. Das war der Spitzenwert in NRW, wie die Rheinische Post damals berichtete. Im Gegenzug behauptete Ziebs, die Werte der statistischen Landesbehörde für die einzelnen Kommunen seien nicht miteinander vergleichbar. Man mag über die Absichten der EU denken, wie man will. Das Beispiel aus Solingen zeigt, dass eine Transparenz in der Ermittlung der Wasserpreise sowie in der Vergabe der Wasserkonzessionen – denn das eine muss mit dem anderen einhergehen, will man sich auf dem freien Markt positionieren – nicht da ist. Oftmals, wie im Falle der SWS, ist der Wasserversorger alleiniger kommunaler Anbieter. Im Falle der SWS kommt dazu, dass die Stadt Solingen mit ihrer Beteiligungsgesellschaft selbst 95% an den Stadtwerken hält. Die Instanz, die die Vergabe der Konzessionen regelt, geht somit nahtlos in jene über, die sie erwirbt.
Für wirkliche Transparenz sorgt nur Preisermittlung auf Nachfrage
Die kommunale Wasserversorgungspolitik wird in Solingen von einer Mehrheit getragen. Auch in vielen anderen Kommunen ist diese Praxis nicht nur bewährt, sondern für viele auch beruhigend. Seit 2005 häuften sich aber bundesweit die Fälle, in denen die jeweiligen Landeskartellbehörden die regionalen Wasserversorger nach einer Erklärung für den hohen Wasserpreis baten, oder, wie in Baden-Württemberg mit dem Unternehmen Calw, eine Preissenkung durchsetzen wollten. Hintergrund ist das 2005 erneuerte Umweltstatistikgesetz. Es verpflichtet seit 2007 die Wasserversorger zu einer Angabe der Wasserkosten beim Statistischen Bundesamt. Auch wenn für die Wasserversorger hierdurch der bürokratische Aufwand gestiegen sein dürfte, so ermöglicht das Umweltstatistikgesetz Einblick in das komplexe Verfahren der Wasserpreisberechnung.
Dies beginnt schon dabei, aus welcher Quelle das Wasser vor seiner Reinigung bezogen wird. Im Falle Solingens kommt der Großteil des Trinkwassers aus der Sengbachtalsperre, bevor es in das Wasserwerk Glüder gelangt. Damit gehört es zu den Oberflächengewässern, für deren Aufbereitung wieder andere Methoden notwendig sind als beim Grundwasser. Zum Beispiel muss Talwasser, nachdem es beim Filtern von allen Bakterien befreit wurde, noch mal mit Calciumcarbonat aufgehärtet werden. Denn: Bei regelmäßigem Durchlaufen von weichem Wasser steigt die Rostgefahr für die Rohre. Dies ist nur ein Beispiel, wie sich die Quelle des Wassers direkt auf die Verarbeitung und damit letztendlich auch auf den Preis auswirken kann. Weitere wichtige Faktoren in der Preisermittlung sind die Kosten der Rohre und Pumpen, die Dichte der Bebauung mit Rohren, die Wasserqualität sowie die Höhe der Konzessionsabgaben an die Kommunen. Für eine wirkliche Transparenz müsste der Wasserversorger dazu übergehen, seine Preisermittlung auf Nachfrage parat zu haben. Der Weg ist lang, bleibt aber notwendig. Die Alternative heißt Spekulieren.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Was ist mit dem Wasser los?
Was ist mit dem Wasser los?
Die Europäische Union plant die Privatisierung der Wasserversorgung – THEMA 04/13 Unser Wasser
 „Das Trinkwasser in kommunaler Hand“
„Das Trinkwasser in kommunaler Hand“
Johannes Slawig über alte und neue Organisationsformen der Stadtwerke – Thema 04/13 Unser Wasser
 „Private Betreiber könnten das Wasser verteuern und die Qualität verringern“
„Private Betreiber könnten das Wasser verteuern und die Qualität verringern“
Paul Kröfges über Probleme bei der Wasserversorgung aus Sicht des Umweltschutzes – Thema 04/13 Unser Wasser
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Noch einmal schlafen
Teil 1: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 1: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 1: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 3: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 3: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 3: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Keine Politik ohne Bürger
Wie Belgien den Populismus mit Bürgerräten und Dialogforen kontert – Europa-Vorbild: Belgien
Der Marmeladen-Effekt
Eine interaktive Mission durch die Küchentischpsychologie – Glosse
Kli Kla Klacks
Intro – Genug für alle
Die Mär vom Kostenhammer
Teil 1: Leitartikel – Das Rentensystem wackelt, weil sich ganze Gruppen der solidarischen Vorsorge entziehen
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 1: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
Der Kitt einer Gesellschaft
Teil 1: Lokale Initiativen – Der Landesverband des Paritätischen in Wuppertal
Gerechtigkeit wäre machbar
Teil 2: Leitartikel – Die Kluft zwischen Arm und Reich ließe sich leicht verringern – wenn die Politik wollte
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 2: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
Gegen die Vermüllung der Stadt
Teil 2: Lokale Initiativen – Umweltschutz-Initiative drängt auf Umsetzung der Einweg-Verpackungssteuer
Gleiches Recht für alle!
Teil 3: Leitartikel – Aufruhr von oben im Sozialstaat
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 3: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
Klassenkampf im Quartier
Teil 3: Lokale Initiativen – Bochums Stadtteilgewerkschaft Solidarisch in Stahlhausen