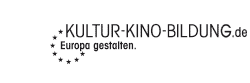Ein Dorf in Kurdistan
Ronya Othmanns Debüt „Die Sommer“ – Wortwahl 10/20
Leyla verbringt als Kind ihre Sommer in Kurdistan – nein, das soll sie so nicht sagen. Sie besucht ihre Großeltern, soll sie sagen, in Syrien. Das ist die sichere Antwort, die, die am wenigsten Fragen aufwirft und noch am besten von ihrer deutschen Umwelt verstanden wird. Ihre Familie väterlicherseits lebt in einem kleinen Dorf direkt an der Grenze zur Türkei. Die heißen Sommer gestalten sich zwischen der Pflege des Gartens und der Hühner, Besuchen von Nachbarn mit Tee und Nächten unter freiem Himmel. Leylas Erinnerungen sind vor allem von ihrem innigen Verhältnis zu der Großmutter geprägt. Die lehrt sie Religion und Geschichte, warum sie keinen Blattsalat essen soll und wie man Weinblätter richtig rollt.
Trotz dieser engen Beziehung bleibt aber immer auch eine Distanz zu ihrer Familie, denn Leyla lebt in Deutschland, ist dort aufgewachsen, besucht ein Gymnasium – wie ihre Mutter, aber eben nicht ihre Cousinen, Tanten, Onkel. Auch wenn sie sich ihrer Familie und dem Dorf verbunden fühlt, fällt sie auch raus. Sie bleibt immer die, die aus Almanya kommt. Aber so ergeht es ihr auch in Deutschland: Ihre Freunde kennen sich kaum mit kurdischer Geschichte aus, sind überfordert, wenn das Thema darauf kommt. Eine Zerrissenheit zwischen Leyals Welten lässt sie ihre Identität und Zugehörigkeit hinterfragen. Ist sie überhaupt Jesidin? Ist das überhaupt ihre Kultur?
Ihr innerer Konflikt spitzt sich zu – zusammen mit der politischen Situation im Jahr 2011. Mit Kriegsausbruch kann Leyla nicht mehr ihre Familie besuchen. Sie verbringt ihren ersten Sommer in Deutschland und macht übliche Teenager-Dinge, wie Seebesuche und Besäufnisse. Parallel ist zuhause das einzige Thema die Nachrichtenlage: Der Vater verbringt seine Tage vor dem Fernseher, die Mutter unternimmt einen zermürbenden Versuch nach dem anderen die Familie aus dem Kriegsgebiet zu holen. Die sorgenfreien Aktivitäten einer Jugendlichen werden überschattet von Hilflosigkeit, verstärkt von dem Gefühl mit ihrem Umfeld über ihre Geschichte nicht sprechen zu können. Sie fühlt sich isoliert, irgendwie von allem.
Die Journalistin und Studentin am Literaturinstitut Leipzig Ronya Othmann gibt in ihrem autobiografisch geprägten Debüt „Die Sommer“ einen kleinen Einblick in eine deutsch-jesidisch-kurdische Lebensrealität, die vielleicht oft übersehen oder verwechselt wird. Othmann schafft ein spannendes, mitreißendes Buch voller Erinnerungen und Erzählungen einer ganzen Kultur, die fest in die Familiengeschichte eingeschrieben sind.
Ronya Othmann: Die Sommer | Hanser | 285 S. | 22 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 von chtren-literatur-b1-unglueckliche-ehen-0425-678.jpg) Unglückliche Ehen
Unglückliche Ehen
„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25
 Die Kunst der zärtlichen Geste
Die Kunst der zärtlichen Geste
„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25
 Mörderischer Hörgenuss
Mörderischer Hörgenuss
Jens Wawrczeck liest „Marnie“ in Bochum
 Über Weltschmerz sprechen
Über Weltschmerz sprechen
„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25
 von chtren-textwelten-0425-678.jpg) Ein wunderbarer Sound
Ein wunderbarer Sound
Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25
 von chtren-vorlesung-verlustschmerz-verstehen-0325-678.jpg) Verlustschmerz verstehen
Verlustschmerz verstehen
„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25
 Cool – cooler – Aal
Cool – cooler – Aal
„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25
 von chtren-sondertext-literatur-nachtga-ste-678.jpg) Aus dem belagerten Sarajevo
Aus dem belagerten Sarajevo
„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25
 von chtren-textwelten-0325-678.jpg) Der legendäre Anruf
Der legendäre Anruf
Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25
 Zwei Freunde
Zwei Freunde
„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25
 von chren-literatur-b1-mehr-als-hunger-und-krieg-678.jpg) „Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25
 Internationales ABC
Internationales ABC
„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25
Erinnerungskultur
Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25
Die Geschichte der Frau
Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25
Der Wolf und die Migranten
Markus Thielemann im Ada – Literatur 02/25