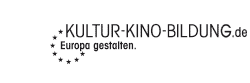Traust du dich?
Die Krise der Institution Ehe ist offensichtlich – für fast alle – THEMA 01/13 EHE-LOS
Mechthild galt in der Klasse als „die Stinkerin“. Sie war pummelig, hatte eine schwarze Hornbrille mit Glasbausteinen als Gläser, trug graue Wollstrumpfhosen unter dem speckigen, karierten Kleid, roch säuerlich und unter ihrem Stuhl bildete sich gelegentlich eine Pfütze. Das alles hätte auch damals, 1963, schon gereicht, sie zur Außenseiterin zu machen. Aber was noch viel schwerer wog als all das: Mechthilds Mutter war geschieden. Sonst hatten alle anderen 42 Kinder der Klasse 1a noch beide Eltern. Es gab niemanden in der Klasse, dessen Eltern aus einem anderen Land kamen. Die Kinder der Zugezogenen, also derjenigen, die nicht seit mehreren Generationen in jenem Dorf wohnten, konnte man an einer Hand abzählen. Das Wort homosexuell war verpönt, die Wörter schwul und lesbisch unbekannt.
Das Dorf von vor 50 Jahren ist inzwischen eingemeindet. Backsteinmietskasernen und ein Villenviertel wurden zwischen dem kleinen Örtchen und der großen Stadt gebaut. Und heute findet am Rande des urbanen Lebens etwas statt, das Mechthild damals nicht erlebt hat: Toleranz. Nicht nur in den Szenequartieren Ölberg und Luisenviertel ist die Familie aus der Margarine-Werbung inzwischen eine Minderheit. Auch in weniger illustren Gegenden gibt es die Patchwork-Familie als zukunftsweisende Form menschlichen Zusammenlebens.
Der Animationsfilm Ice Age gilt als klassische Vorlage. Aus der Not heraus finden sich unterschiedliche Individuen zusammen, um sich Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Schwester und Bruder zu sein. Dass Ehen nicht mehr so lange halten wie früher, ist inzwischen weithin bekannt. Auch dass sich immer mehr Menschen nicht trauen, einen Trauschein zu beantragen, hat sich weitestgehend herumgesprochen. Aber es gibt inzwischen sehr viel buntere Möglichkeiten des kollektiven Wohnens und Lebens als die Ehe. Es gibt Regenbogenfamilien, also Kinder mit zwei homosexuellen Erwachsenen, die sich für die Kinder zuständig erklären. Es gibt Eltern, die sich einfach nicht verheiraten lassen wollen. Es gibt Elternteile, die mit neuem Lebenspartner ihre Kinder aufziehen. Früher galt: Eltern haben oft vier Kinder. Heute gilt: Kinder haben oft vier Eltern. Die Möglichkeit, Kinder allein zu betreuen, ist inzwischen auch weit verbreitet, birgt aber die Risiken der Verarmung, Überarbeitung und Vereinsamung. Trotzdem sind viele Alleinerziehende mit ihrer Situation glücklicher als Menschen, die zur Zweisamkeit vergattert wurden.
Vorübergehende Ordnung im Affengehege
Die Ehe als Versprechen immerwährender Liebe ist übrigens eine Erfindung aus dem letzten Jahrhundert. Früher standen handfeste ökonomische Zwänge im Vordergrund. Könige und Fürsten vergrößerten durch die Heiraterei ihre Machtbereiche, Bauern ihre Höfe. Immer war eine Hochzeit der Beginn einer wunderbaren Geschäftsbeziehung. Stopfst du mir meine Strümpfe und bügelst meine Hemden, gebe ich dir Nahrung und Obdach. So gesehen ist das Ehegattensplitting die Fortsetzung der mittelalterlichen Mitgift. Gibt es wegen fortschreitender Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern immer weniger Anreize, sich einem Partner ökonomisch auszuliefern, muss der Staat helfend eingreifen. Mit Lohnsteuerklasse IV ist die Aufnahme einer schlecht bezahlten Tätigkeit kaum lohnend. Und gerade nach durchlebter Babypause, die sich gern zur mehrjährigen „Familienphase“ aufbläht, ist ein hochdotierter Job eher die Ausnahme. Nicht selten bedeutet das hierzulande: Muttern bleibt zu Hause und kümmert sich um die Brutpflege.
Wie aber ist es eigentlich um die Liebe bestellt, die doch inzwischen der Grund für eine lebenslängliche Eheschließung sein soll? Sind wir Menschen treu wie Störche und Schwäne, die die Liebe auf den ersten Blick und die ewige Treue kennen? Oder geht es unter uns Menschen nicht eher so kunterbunt zu wie bei den Affen auf dem berühmten Felsen? Genetisch gesehen sind wir den Affen näher als dem monogamen Federvieh. Noch vor wenigen Jahrzehnten sorgte die herrschende Moralvorstellung zumindest von außen gesehen für entsprechende Ordnung im Affengehege. Aber nach der sexuellen Revolution, der Einführung der Antibabypille und dem neuen Scheidungsrecht, das keine schuldhaft geschiedene Ehe mehr kennt, ist die Ehe in die Krise geraten. Nach den Jahrzehnten, in denen häufig geschieden wurde, folgen nun die Jahrzehnte, in denen sich Menschen überhaupt nicht mehr trauen. Im Jahr 2011 heirateten laut Statistischem Bundesamt 6,8 Prozent weniger Paare als im Jahr zuvor. Die Geburtenrate ging zwar auch zurück, allerdings weniger stark, nämlich um 3,9 Prozent. Moderne Familienpolitik müsste sich also an der gesellschaftlichen Realität orientieren, statt ideologische Erwartungen zu erfüllen. Statt Ehen steuerlich massiv zu subventionieren, sollte der Staat mehr Geld in die Förderung der Kinder stecken. Ob ein Kind glücklich bei verheirateten Eltern aufwächst oder bei unverheirateten, ob bei den leiblichen Eltern oder in Patchwork-Familien, ist zweitrangig. Entscheidend sollte das Kindswohl sein.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 „Braucht die Institution Ehe eine steuerliche Begünstigung?“
„Braucht die Institution Ehe eine steuerliche Begünstigung?“
Andreas Bialas über Familienpolitik aus sozialdemokratischer Sicht – Thema 01/13 Ehe-Los
 von engels_Thema_Seite 2_unten.jpg) „Für eine ideologiefreie Familienpolitik“
„Für eine ideologiefreie Familienpolitik“
Marcel Hafke über das Verhältnis der FDP zu Ehe und Familie – Thema 01/13 Ehe-Los
 Julia und Julia
Julia und Julia
Shakespeare muss umgeschrieben werden – Romeo ist nicht erforderlich – Thema 01/13 Ehe-Los
 von engels_Thema_Seite 3_unten.jpg) Doppelt hält besser
Doppelt hält besser
Szenen einer türkisch-deutschen Ehe – Thema 01/13 Ehe-Los
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Noch einmal schlafen
Teil 1: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 1: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 1: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 3: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 3: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 3: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Keine Politik ohne Bürger
Wie Belgien den Populismus mit Bürgerräten und Dialogforen kontert – Europa-Vorbild: Belgien
Der Marmeladen-Effekt
Eine interaktive Mission durch die Küchentischpsychologie – Glosse
Kli Kla Klacks
Intro – Genug für alle
Die Mär vom Kostenhammer
Teil 1: Leitartikel – Das Rentensystem wackelt, weil sich ganze Gruppen der solidarischen Vorsorge entziehen
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 1: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
Der Kitt einer Gesellschaft
Teil 1: Lokale Initiativen – Der Landesverband des Paritätischen in Wuppertal
Gerechtigkeit wäre machbar
Teil 2: Leitartikel – Die Kluft zwischen Arm und Reich ließe sich leicht verringern – wenn die Politik wollte
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 2: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
Gegen die Vermüllung der Stadt
Teil 2: Lokale Initiativen – Umweltschutz-Initiative drängt auf Umsetzung der Einweg-Verpackungssteuer
Gleiches Recht für alle!
Teil 3: Leitartikel – Aufruhr von oben im Sozialstaat
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 3: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland