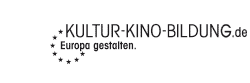„Der Begriff ,Heimat‘ ist vieldeutig“
Direktor Fritz Emslander über „Es gibt kein Wort …“ im Museum Morsbroich – Sammlung 05/24
Das Museum Morsbroich in Leverkusen zeigt aktuell die Ausstellung „Es gibt kein Wort …“ Darin beschäftigen sich fünf Künstler:innen mit ihrer Vorstellung von Heimat. Ein Gespräch mit Museumsdirektor und Kurator Fritz Emslander.
engels: Herr Emslander, die Ausstellung heißt „Es gibt kein Wort …“ Können wir überhaupt ein Interview darüber führen?
Fritz Emslander: Ja, doch! Denn wir sprechen über ein Thema, das man mit dem Begriff „Heimat“ überschreiben könnte. Aber dieser Begriff ist nicht griffig. Die Frage, was Heimat für den einzelnen Menschen bedeutet, wird jede oder jeder anders beantworten, abhängig von der Lebenssituation, der Herkunft und der jeweiligen Familiengeschichte. So beantworten das auch die Künstler:innen, die wir für die Ausstellung eingeladen haben. Der Begriff „Heimat“ ist vieldeutig, er ist in der Geschichte ideologisch vereinnahmt worden und verbrannt worden, deshalb haben wir ihn im Titel auch weggelassen.
Was ist in der Ausstellung zu sehen?
Werke von fünf Künstler:innen, die sich schon länger mit dem Thema befassen. Ahmet Doğu İpeks Arbeit ist am Anfang zu sehen. Sie thematisiert die Verwurzelung, die eigene Herkunft – tatsächlich mit einer Wurzel, die er in einer Metamorphose mit Schnitzwerk in einen Tisch verwandelt. Es ist ein ambivalentes Werk, das sich zwischen den Bereichen Natur und Kultur bewegt – auf beide beziehen wir uns ja auch, wenn wir unserer eigenen Identität auf den Grund gehen wollen. Das ist ein Anfangspunkt. Dann sind Videoarbeiten der in Usbekistan geborenen Künstlerin Ira Eduardovna zu sehen, wo es zwar ganz stark um Momente ihrer Biografie geht, die aber so emotional berührend mit Schauspieler:innen inszeniert sind, dass die dort thematisierte Auswanderung, die Migration, das Verlassen der alten Heimat und die Sehnsucht danach ganz allgemein verständlich und übertragbar sind.
Zwei Künstlerinnen der Ausstellung kommen aus Kiew, oder?
Genau. Das ist Zoya Cherkassky, die in Kiew aufgewachsen ist, zwei Wochen vor Zusammenbruch der Sowjetunion mit der Familie nach Israel ausgewandert ist und dort in der russisch-ukrainischen Community gelebt hat. Vor ihrem Atelier porträtierte sie Mitglieder der schwarzen Community von Tel Aviv, dort hat sie ihren nigerianischen Mann kennengelernt. Aktuell ist ihre Heimat in Israel wieder bedroht, wieder in Frage gestellt; in der Ukraine ist mit Beginn von Putins Angriffskrieg zugleich die Basis ihrer Kindheitserinnerungen endgültig zerstört worden. Wir zeigen in einem Raum Werke aus der großen Serie „My Sowjet Childhood“, in der sie auf ihre frühen Jahre in der UdSSR zurückblickt. Die zweite Künstlerin aus Kiew, Yevgenia Belorusets, ist Autorin und Fotokünstlerin, wohnt momentan in Berlin, nur noch teilweise in Kiew. Mit ihr realisieren wir eine Intervention im öffentlichen Raum auf Billboards, auf großen Plakatflächen also, und auch bei uns auf dem Museumsgelände. Das sind Foto-Arbeiten mit Blicken in den Himmel über einer Stadt. Die dort sichtbaren Stromleitungen nimmt sie als Zeilen und schreibt darauf Zitate verschiedener Menschen, die ihr von ihren Erinnerungen an Kiew erzählt haben. Aus heutiger Sicht sind das sehr unbedarfte, unerhört naiv erscheinende Erinnerungen, die nicht mehr mit den abscheulichen Kriegsbildern zusammengehen wollen, die wir nun im Kopf haben.
Kommt die Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat angesichts des aufstrebenden rechten Populismus nicht etwas spät?
Die Auseinandersetzung mit Heimat ist ja etwas Existentielles, Menschliches. Die hat es immer gegeben. Natürlich kann man das aktuell in den Kontext politischer Diskussionen setzen, aber zugleich geht es um eine Frage, die uns alle mehr oder weniger umtreibt. Der Begriff „Heimat“ wird nicht mehr so statisch mit dem Geburtsort verbunden wie früher. „Heimat“ ist für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich, weil sie bedroht ist oder weil wir uns von ihr entfremden. Sie steht zur Disposition: Wo und worin sucht und findet man Heimat, wie definiert man sie für sich ganz persönlich? Das sind Fragen, deren Beantwortung wir nicht dem politischen Spektrum rechts außen überlassen dürfen.
 Ira Duardovna, On foreign made soles, 2018 (7-Kanal-Videoinstallation, 19 Min., Still), © Ira Eduardovna, © Foto: Ira Eduardovna
Ira Duardovna, On foreign made soles, 2018 (7-Kanal-Videoinstallation, 19 Min., Still), © Ira Eduardovna, © Foto: Ira EduardovnaAber die Ausstellung ist kein Laboratorium für ein Revival der deutschen Romantik?
Auf gar keinen Fall. Auch die fünfte Künstlerin, Jody Korbach, verfällt sicher nicht dem Romantizismus, sondern sieht das Thema mit scharfem Blick, mit teils bissigem Humor und kritischer Distanz, wenn sie sich etwa mit dem Fußball als Identifikationsraum beschäftigt und an der Kunstakademie Düsseldorf einen eigenen Fanclub aufmacht. In Dortmund aufgewachsen, hat sie nicht nur die dortige Nazi-Szene kennengelernt, sondern auch die Welt der Fans, die sich ein Leben lang mit ihrem Verein verbunden fühlen. Wie man das eben auch mit der Heimat tut, wenn es gut läuft. Jody Korbach hat darüber hinaus auch ihr eigenes „Schützenkorps Europa“ gegründet, um das Thema Europa quasi vom Stammtisch her anzupacken. Da ist schon auch Lust an der Verkleidung dabei, aber auch echte Faszination für diesen Bereich des Brauchtums und der kulturellen Traditionen, der unheimliche Energien freisetzt und mit dem sich so viele nach wie vor identifizieren. Wie die Fußballstadien sind die Schützenfeste Orte, an denen ein Wir-Gefühl, so etwas wie „Heimat“ greifbar wird. Da kann man sich von der Begeisterung anstecken lassen – oder auf kritische Distanz gehen und sich fragen, woran man eigentlich selbst heimatliche Gefühle knüpft.
Es gibt kein Wort … | bis 25.8. | Museum Morsbroich, Leverkusen | 0214 406 45 00
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 „Alltägliche Dinge, die uns fremd werden“
„Alltägliche Dinge, die uns fremd werden“
Kurator Fritz Emslander über „Zusehends“ von Eric Lanz im Museum Morsbroich – Sammlung 03/25
Dialog auf Gegenseitigkeit
„yours truly,“ im Museum Schloss Morsbroich – Kunst in NRW 07/23
Öffentliche Orte
Mischa Kuball in Leverkusen und Marl – Kunst in NRW 01/22
 von nrw-kunst37.jpg) Fremde Räume
Fremde Räume
Simon Schuberts „Schattenreich“ in Leverkusen – Kunst in NRW 02/20
 von nrw kunst k.jpg) Freude am Einrichten
Freude am Einrichten
„Interieur als Porträt“ in Leverkusen – Kunst in NRW 03/16
In allen Satteln zu Hause
Hans Salentin in Mülheim und Leverkusen – Kunst in NRW 08/13
Hannibal, ungeschönt
Latefa Wiersch im Dortmunder Kunstverein – Kunst 03/25
Geschichten des Lebens
Anna Boghiguian im Kölner Museum Ludwig – Kunst 02/25
Die Welt als Suppe
„Vida y Muerte“ von Miquel Barceló in Duisburg – kunst & gut 02/25
„Er hat sich den Berserker der Malerei genannt“
Kuratorin Anna Storm über „Maurice de Vlaminck. Rebell der Moderne“ im Von der Heydt-Museum – Sammlung 01/25
„Den Cartoons wohnt eine Zeitlosigkeit inne“
Kuratorin Sarah Hülsewig über die Ausstellung zu Loriot in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 12/24
„Ein lebendiger Ort“
Kuratorin Isabelle Meiffert über „Shared Spaces“ in der Kunsthalle Barmen – Sammlung 11/24
Schnittige Raumkonzepte
Lucio Fontana im Von der Heydt-Museum – kunst & gut 11/24
„Entscheidend ist, überzeugend in seiner Arbeit zu sein“
Die Wuppertaler Bildhauerin Beate Schroedl-Baurmeister ist auf der 60. Kunstbiennale in Venedig vertreten – Interview 11/24
Der Kombinator
Eduardo Paolozzi im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 10/24
„Es geht bei ihm ja immer um Löcher und Schnitte“
Direktor Roland Mönig über „Lucio Fontana: Erwartung“ im Von der Heydt-Museum – Sammlung 10/24
Pinselschwung aus Plexiglas
Berta Fischer im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 09/24
Freie Form
„Jean Fautrier – Genie und Rebell“ im Emil Schumacher Museum Hagen – kunst & gut 08/24
„Auch die Sammler beeinflussen den Künstler“
Kurator Markus Heinzelmann über die Ausstellung zu Gerhard Richter in Düsseldorf – Sammlung 08/24
Stofftier und Poltergeist
Mike Kelley im Düsseldorfer K21 – kunst & gut 07/24
„Der haarlose Körper wird als ein Ideal stilisiert“
Kuratorin Ellen Haak über „Hairytales“ im Düsseldorfer Museum Kunstpalast – Sammlung 07/24
Nicht nichts
100 Jahre Abstraktion im Wuppertaler Von der Heydt-Museum – kunst & gut 06/24
„Keine klassischen Porträtfotografien“
Kuratorin Kerrin Postert über „UK Women“ in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Sammlung 06/24
Mit fremden Federn
Lothar Baumgarten im Von der Heydt-Museum – kunst & gut 05/24